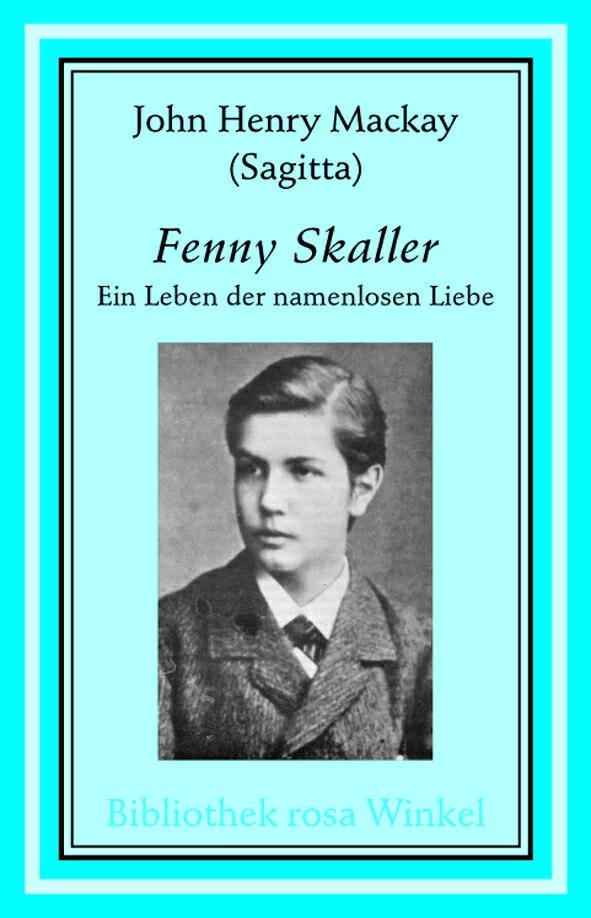
Fenny Skaller
von John Henry Mackay (Sagitta)
Paperback, 176 Seiten
Veröffentlichung: September 2007
Fenny Skaller
Fenny Skaller, ein Mann in den Vierzigern, blickt zurück auf sein Leben. Anhand von Fotos erlebt er erneut Enttäuschungen und beglückende Momente, erinnert er sich, wie ihm allmählich bewusst wurde, dass er Jungen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren liebt. Ein Zeitungsjunge in Paris, der Fenny Skaller ein Foto von sich geschenkt hat, öffnete ihm die Augen für die Möglichkeit, dass auch diese Form der Liebe auf Erwiderung hoffen darf: „Sie küssen mein kleines Bild, Monsieur – Warum küssen Sie nicht lieber mich selbst?“ Der Roman trägt deutlich autobiographische Züge.
Friedrich Kröhnke zu dem vor rund hundert Jahren geschriebenen Text: In Berlin erlebt Fenny Skaller in allen Spielarten die „namenlose Liebe“, es ist Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, und alles ist so frisch, als wäre es gestern geschrieben, gestern geschehen. Sicher macht es mich schmunzeln, wenn Fenny seine „Cigarre“ raucht, auf der Straße einen Jungen kennen lernt, weil ihm zufällig „sein Stock entgleitet“, er den Fünfzehnjährigen nun siezt. Und doch sind die Begegnungen, die Typen, die Psychologie kein bisschen anders als heute, wenn Männer und Jungen einander begegnen, solche Männer und solche Jungen. Es frappiert. Es bestürzt geradezu. Selbst Mackays gleichbleibend erhabener Ton wird unterbrochen und ergänzt und wahr, wenn die Jungen reden: „Ich kann nur das Gequatsche nicht leiden.“
BIOGRAFIE
JOHN HENRY MACKAY , der deutsche Autor mit dem englischen Namen, wurde 1864 in Schottland geboren. Sein Vater starb früh, die Mutter, eine Deutsche, kehrte mit dem Sohn in die Heimat zurück. Mackay machte eine Ausbildung zum Verlagsbuchhändler, studierte, lebte zeitweilig in London, Paris, Rom und Saarbrücken und ließ sich 1892 in Berlin nieder. Nach ersten literarischen Erfolgen mit Sachbuch- und Gedichtbänden, startete er 1905 unter dem Pseudonym „Sagitta” die Reihe “Bücher der namenlosen Liebe”, in der zwischen 1906 und 1926 sieben Bände erschienen. Mackay starb 1933 nach einer Phase der Krankheit in Berlin.
LESEPROBE
AUSZUG AUS „FENNY SKALLER“ VON JOHN HENRY MACKAY (SAGITTA)
„Georges, mon petit Georges!“ – unwillkürlich glitt über Skallers Lippen der Schmeichelname wieder, mit dem er ihn so unzählige Male geliebkost.
In Paris hatte er ihn gefunden, an einer Straßenecke, wo er hungernd und frierend in seinem blauen, aber sorgfältig geflickten Kittel seine Zeitungen ausrief. Er kaufte sie bei ihm, sprach mit ihm ein paar Worte, beschenkte ihn. Es war seine einzige Freude. Er kannte Niemand in Paris. Er ging nie an die Ecke ohne daß sein Herz klopfte. Er war ja noch so dumm und unerfahren, und glaubte immer noch, die ganze Welt verfolge ihn und diese kleine Liebe, und immer fürchtete er noch, ihn zu verlieren, wenn der kleine Gamin ahnte, wie sehr er ihm gefiel. Wie dumm er noch gewesen war, damals . . .
Aber eines Abends trafen sie sich doch. Skaller noch ganz befangen innerlich, aber der kleine Franzose lustig und gesprächig: vor einem der kleinen Cafés an der großen Place de la République, im Schatten der Häuser, an einem der gelben Tischchen von Blech. An diesem Abend erhielt er dies kleine Bild. Als sie sich schon verabschiedet und Skaller es wieder betrachtete, beim Scheine der Laterne, und es heimlich an die Lippen führte, stand der Junge wieder vor ihm mit seinem schelmischen, ein wenig spöttischen, aber so freundlichen Lächeln: „Sie küssen mein kleines Bild, Monsieur – Warum küssen Sie nicht lieber mich selbst? – –“
Die Straße war leer. Aber wenn die Menschen dicht um sie herumgestanden hätten – in diesem Augenblicke hätte ihn Nichts gehindert, den Jungen in die Arme zu nehmen vor allen Leuten. An diesem Abend trennten sie sich nicht mehr und viele Tage nicht. Denn j e t z t war der Bann gebrochen und endlich begann er zu sehen . . .
– Seltsam: nicht aus den Wochen, die diesem Abend folgten, und die für ihn waren wie ein schöner und warmer Sommer voll Duft und Licht nach einem langen und harten Winter, diesen Wochen, in denen sie glücklich auseinandergingen, um sich glücklich wiederzusehen, und in denen Alles Frohsinn und Lachen, Güte und Freundlichkeit, Hingabe und echte Zuneigung gewesen war, Wochen, in denen sie, das getretene und verstoßene Kind der Straße, das in seinem Leben wohl nie ein freundliches oder gar ein liebevolles Wort gehört, und er, der vereinsamte, weit über seine Jahre hinaus ernste junge Mann, der sich bisher allein geglaubt in der Welt mit seinem furchtbaren und unlösbaren Geheimniß, eins gewesen waren in ihrer Zuneigung zu einander, eins wie Kinder und wie Brüder – seltsam: nicht aus diesen Wochen, wo alle Tage in einen ineinanderrannen voll Sonne und Wärme, nicht aus diesen langen und doch zu kurzen Wochen hob sich heute vor Skallers Augen ein bestimmtes Bild der Erinnerung, sondern aus Jahren, Jahren nach diesem Jahr, stand wieder vor ihm eine Szene, formte sich und rief ihm noch einmal dies sein erstes großes Glück, diese seine erste kleine Neigung zurück . . .
Und – das verwischte Bild in der Hand, auf das die Schatten der Dämmerung von außen fielen – sah er sich wieder, um Jahre gealtert, fern von Paris, müde und muthlos sein Leben weiter zu tragen, in einem jähen Anfall von Verzweiflung seine Koffer packen, zusammenraffen, was er besaß, und mit dem nächsten Zuge Tag und Nacht zurückfahren nach der Stadt, wo er glücklich gewesen war, um – er wußte nicht was zu thun: – vielleicht um zu suchen, was doch auf immer verloren war . . .
– Und dies war es, was er wieder heute sah mit einer fast schreckhaften Deutlichkeit: Der Zug rast und rast. Es wird dunkel und wieder hell. Die Städte und Menschen wechseln. Statt der deutschen schlagen wieder französische Laute an sein Ohr. Er aber hört und sieht Nichts: in der Ecke, in die er sich beim Einsteigen gesetzt, sitzt er noch, bis er angelangt ist, sieht hinaus zum Fenster des Zuges, wo unaufhörlich die Telegraphendrähte sich heben und senken, und denkt immer an das Eine . . . immer an das Eine nur . . . : Er hat ihn damals erlöst . . . er muß ihn wieder erlösen, wie damals! . . .
Endlich ist er in Paris. Eine schwarze Halle: der Gare du Nord. Er besteigt die Droschke, nennt den Namen des Hotels, desselben Hotels, in dem er auch damals gewohnt, reinigt sich schneller, als es seine Art ist, von dem Staub der Reise, und geht auf die Straße. Er achtet auf Nichts: er geht die Boulevards hinab, an St. Lazare vorbei, durch dunkelnde Straßen hinauf zum Nordosten der Stadt. Er kennt den Weg.
Er geht und geht. Die Straßen werden dunkler und leerer, enger und unheimlich. Er irrt sich in keiner. Er umbiegt Ecke um Ecke. Er findet die, die er sucht. Er findet das Haus. Er steht vor ihm: ein Maison meublée, nicht einladender, nicht abstoßender, wie tausend andere in Paris. Aber dies ist es.
Er klopft. Die Thür öffnet sich wie von selbst. Der Concièrge sieht aus seinem Verschlag.
– „Die Nummer Vier, wenn sie frei ist, bitte”, sagt er. Er schiebt sein Geldstück hin, erhält seinen Leuchter und den Zimmerschlüssel, steigt die ausgetretene Treppe hinan und ist in dem Zimmer.
Es ist noch genau so, wie es damals war. Nüchtern und kahl, aber ganz sauber. Selbst die Möbel stehen noch so, wie sie damals standen. Aber wie Viele mögen seitdem hier aus und eingegangen sein! – Wie Viele! – und wer! – –
Einmal noch sieht er sich um, mit einem langen Blick. Dann setzt er sich auf den Stuhl an das Fenster, denselben Stuhl, auf dem er so oft gesessen, wenn er ihn erwartet, oder wenn er ihn auf den Knieen hielt, seinem lustigen und altklugen Geplauder lauschend, und mit ihm hinunterschauend auf die häßliche Straße. So sieht er auch jetzt wieder hinunter. Als ob er warte. Zuweilen schleicht ein Mensch an der Häuserwand dort drüben vorbei wie ein Schatten. Ein Kind schreit. Ein Betrunkener lärmt herauf. Im Hause aber dasselbe geheimnißvolle, verschwiegene Kommen und Gehen, wie damals: eine Thür wird zugeschlagen; der unterdrückte Schrei einer Stimme dringt durch die dünnen Wände; über die Gänge schlürfen Schritte wie von Menschen, die sich hier lieber nicht begegnen wollen, hier in diesem Hause der – Liebe . . .
Kommt er noch nicht? – Warum kommt er denn noch nicht? – Es ist doch Zeit. Er ist doch immer gekommen. Warum kommt er heute nicht? –
Eine schreckliche Unruhe steigt in ihm auf. Er zittert vor Sehnsucht. Sie treibt ihn auf . . .
Da sieht er das Bett, das große, weiße Bett, das fast das ganze enge Zimmer füllt. Und mit einem Schrei stürzt er darauf zu, breitet die Arme über die weißen Kissen, als hielte er mit ihnen ihn wieder: den weißen, jungen, so liebevollen und so leidenschaftlichen Körper, wieder wie damals!
„Georges, mon petit Georges!”
Auszug aus „Fenny Skaller – Das vierte Bild”