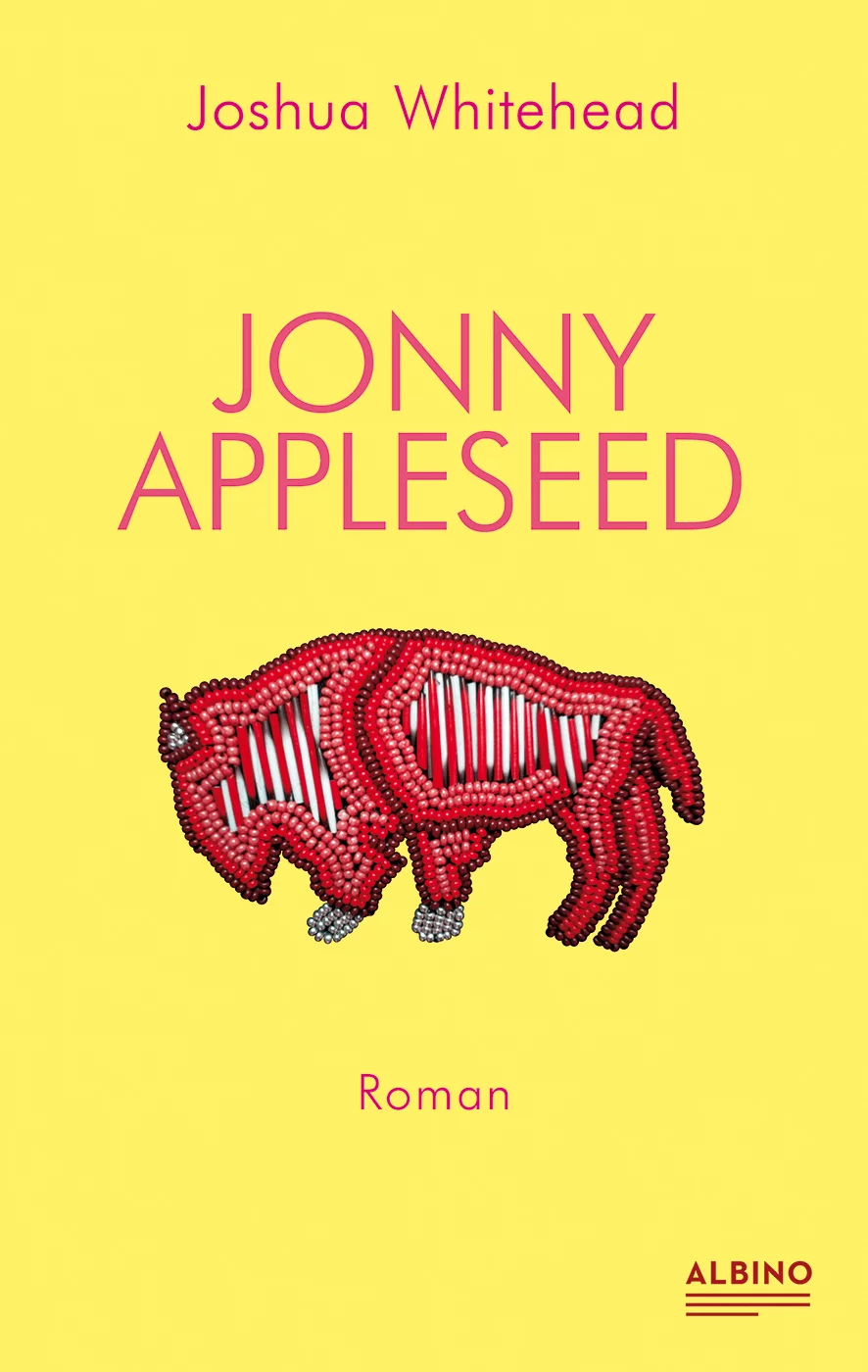
Jonny Appleseed
von Joshua Whitehead
Aus dem Englischen übersetzt von Andreas Diesel
Klappenbroschur, 256 Seiten
Veröffentlichung: März 2020
Jonny Appleseed
Two-Spirit, queer und „NDN Glitzerfee“ — das ist Jonny Appleseed. Der Angehörige des Volkes der Oji-Cree hat das Reservat verlassen und schlägt sich in Winnipeg als Sexarbeiter durch. Viele seiner weißen Kunden sind vom Indianer-Mythos fasziniert und glauben, er könne wie ein Naturgeist seine Gestalt wechseln. Jonny liebt die Freiheit, die ihm die Großstadt bietet, und bleibt doch ganz und gar verwurzelt in den Traditionen seines Volkes und seiner Familie.
Als er vom Tod seines Stiefvaters erfährt, bleibt ihm eine Woche, bis er zu dessen Beerdigung ins Reservat zurückkehren muss. Während er mit Online-Sex das Geld für die Reise verdient, führen ihn seine Gedanken, Träume und Erinnerungen immer wieder zurück in die Vergangenheit: zu seinem Erwachsenwerden im Reservat, seiner großen Liebe Tias und zu seiner geliebten Mutter und Großmutter, deren Weisheiten ihm stets Halt im Leben geben.
Joshua Whiteheads Debütroman ist ein bahnbrechendes Buch, das in einer mitreißenden Sprache und berührenden Traumbildern vom Leben eines indigenen, queeren Two-Spirit zwischen Akzeptanz und Ablehnung, zwischen Rebellion und Tradition erzählt.
ÜBER DEN AUTOR
JOSHUA WHITEHEAD, kanadischer Oji-Cree aus Manitoba, forscht als Doktorand über indigene Literatur an der Universität von Calgari. Sein Gedichtband „Full-Metal Indigiqueer“ (2017) fand bei der Kritik große Beachtung. „Jonny Appleseed“ (2018) ist sein erster Roman, für den er mehrere Auszeichnungen erhielt, u. a. den Lambda Literary Award als bester Roman des Jahres.
LESEPROBE
1
Mit acht wurde mir klar, dass ich schwul bin. Ich blieb spätabends auf, wenn alle anderen schon im Bett waren, und sah mir im Fernsehen meiner Kokum „Queer as Folk“ an. Sie hatte eine Satellitenschüssel und alle Sender, die man so empfangen konnte – natürlich ohne zu bezahlen. Damals wohnten meine Mom und ich bei meiner Kokum, weil mein Dad uns sitzengelassen hatte – ich glaube, er nahm einen Songtext von Loretta Lynn etwas zu wörtlich und kam eines Tages von einer Sauftour einfach nicht mehr nach Hause. „Queer as Folk“ lief um Mitternacht; ich schaltete den Ton aus und die Untertitel an, damit keiner was hörte, und dämpfte die Helligkeit, damit das Licht nicht unter ihren Türen hindurchflackerte wie ein gottverdammter Poltergeist. Ich liebte QAF; ich wollte auch einer dieser schwulen Männer sein und ein tolles Leben in Pittsburgh führen. Ich wollte in einem Loft wohnen, in Schwulenbars gehen, mit süßen Typen tanzen und auf Klappen herummachen. Ich wollte in einem Comicladen oder an einer Universität arbeiten und reich und sexy sein. Das wollte ich. Ich holte mir auf Brian Kinneys Schwanz einen runter und stellte bei Justin Taylors blankem weißem Arsch auf Pause, um zu kommen.Damit die braungeblümte Couch meiner Kokum sauber blieb, brachte ich meine Decke mit und wischte mich mit einem Strumpf ab. Ich hielt immer den Atem an und verkrampfte meine Zehen, um beim Kommen nicht zu keuchen. Als ich dann kam, dachte ich, so muss sich Schönheit anfühlen: meine Haut gespannt und brennend, mein Körper feucht wie Schlamm.
Als ich älter wurde, ich glaube, ich war 15, sah ich Dan Savage und Terry Miller im Internet, die mir sagten, dass es besser wird. Sie behaupteten, sie wüssten, was ich durchmache, sie würden mich kennen. Wie das, fragte ich mich. Ihr kennt mich nicht. Ihr kennt Latte Macchiato und Eigentumswohnungen – ihr habt keinen Schimmer, was es heißt, ein brauner schwuler Junge im Reservat zu sein. Ich hatte damals noch nicht mal eine Starbucks-Filiale gesehen und keine Ahnung, warum man einen kleinen Kaffee dort „groß“ nennt. Das war ungefähr zur selben Zeit, als ich anfing, Freier anzuziehen wie das Licht die Motten, was wenigstens meine finanzielle Situation verbesserte. Das war natürlich vor der Zeit der Apps, mit denen man Fotos austauschen kann, und der Webcam-Sites, mit denen ich mittlerweile meinem Geschäft nachgehe, aber auch damals war das Internet voller Leute, die mit anderen Leuten Kontakt suchten, und das galt vor allem für Peguis. Wir hielten uns mithilfe von Facebook und Handys auf dem Laufenden. Im Chatroom der Gaming-Seite Pogo schickten wir uns gegenseitig schmutzige Textnachrichten. Ich nannte mich Lucia und gab mich als Mädchen aus, um mit anderen Jungs zu flirten. Oft spielten wir Online-Billard oder Dame und plauderten nebenher. Ich gab mich naiv und lenkte das Gespräch auf schmutzige Themen; dabei vermittelte ich ihnen gern das Gefühl, dass sie am längeren Hebel saßen. In dieser Hinsicht bin ich wohl ein bisschen sadistisch. Ich bin vielleicht die sexuelle Fantasie, aber ich bin auch derjenige, der die Fäden in der Hand hat. Hatten die Jungs erst mal Bilder von nackten, verschwitzten Leibern im Kopf, gab es kein Zurück mehr. Sex stellt verrückte Sachen mit Menschen an – es ist wie ein Blackout oder wie Autopilot. Der Körper weiß, was er will, und er nimmt es sich. Das kann gefährlich werden, wie ich später noch herausfinden sollte, aber wer diesen Trieb manipulieren kann, kann eine Person kontrollieren. Ich fühlte mich wie Professor X – wie ein Telepath.
Auf diese Weise begann meine Webcam-Karriere: mit Online-Billard und Cybersex. Auf diese Weise lernte ich Tias kennen. Er war mein erster fester Cyber-Freund – ich war die russische Prinzessin Lucia, und er war der indigene Junge, der sich fünf Jahre älter machte, als er war, und davon träumte, seine Unschuld zu verlieren. Was waren wir doch für ein Paar!
Damals war ich noch ungeoutet, aber in der Schule war allen klar, dass ich anders war. Man nannte mich Schwuchtel, Homo, Tunte – die ganzen netten Sachen eben. Aber ich machte mir nichts draus. Manchmal merkte ich, dass sowohl Mädchen als auch Jungs verstohlen meinen Körper betrachteten. Ich war unter hundert verschiedenen Namen bekannt. Außerhalb meiner Familie nannte niemand mich Jonny; alle nannten mich den „Schluckspecht“. Wer mich in der Zeit zwischen meinem zwölften Lebensjahr und heute kannte, kennt mich wahrscheinlich unter diesem Namen. Ein Schulfreund verpasste mir den Spitznamen, als ich beim Dosenstechen eine Bierbüchse in unter acht Sekunden leertrank; das ist anscheinend Weltrekord für NDNs+. Später spann ich den Spitznamen weiter und nannte mich nach verschiedenen Spechtarten: Ich war Buntspecht, Hüpfspecht, Zwergspecht, WH (als Kurzform von Wendehals); manchmal, vor allem, wenn meine Mom mir von einem Ausflug in die Stadt ein neues Shirt mitgebracht hatte, nannte ich mich auch Woody Woodpecker – weil ich mir so richtig schick vorkam.
Meinen wirklichen Namen Jonny habe ich nie gemocht. Ich wurde nach meinem Dad benannt, einem Schulabbrecher, Alkoholiker und Möchtegern-Countrystar. Ich hörte nie wieder von ihm, nachdem er uns sitzengelassen hatte. Irgendwann fanden wir heraus, dass er bei einem Brand in einem anderen Reservat umgekommen war. Mir macht das nichts aus, aber die Leute vergessen sowas nicht. Wildfremde Menschen fragen mich: „Ach, du bist doch der Sohn von Soundso, dem Säufer?“
Am peinlichsten war jedoch eine Szene in einem christlichen Zeltlager, Camp Arnes. Ein Erzieher namens Stephen ließ uns vorm Essen immer ein Lied singen. Es hieß ‹Johnny Appleseed› und ging so:
Oh, der Herr ist gut zu mir,
deshalb danke ich dem Herrn,
was ich brauche, gibt er mir,
Vater, Mutter, Sonne, Liebe.
Oh, der Herr ist gut zu mir, Johnny Appleseed, Amen.
Klingt toll, was? Nun, in diesem Zeltlager knutschte ich mit meinem ersten Lover Louis – ein Silberfuchs, der wie Stephen als Erzieher im Zeltlager arbeitete –, und als wir gerade in meiner Koje (im Quartier der Rotfüchse) herummachten, erwischte uns einer seiner Kollegen. Es stellte sich heraus, dass Louis eine Freundin im Iglu-Quartier hatte, und als man uns ertappte, regte er sich furchtbar auf und behauptete, ich wäre ihm nachgestiegen. Ein paar Stunden später wusste das ganze Zeltlager von der Sache, und alle fingen an, mich Jonny Rottenseed zu nennen. Siehe da, beim Gebet vorm Essen schloss niemand mehr die Augen oder senkte das Haupt, nein, alle starrten sie mich an und flüsterten miteinander, Ekel und Angst auf den Gesichtern. Offenbar kann ein NDN schon im zarten Alter von zehn Jahren ein schwuler Sexualstraftäter sein. Und was sollte das Ganze überhaupt? Darf ein Junge keine sexuellen Bedürfnisse haben? Ist es wirklich ein Verbrechen, wenn ich meinen Körper selbst berühren und von anderen berühren lassen will? Es ist ja schließlich mein Körper, klaro?
Zurück im Reservat stellte ich in unserer schäbigen kleinen Behelfsbibliothek Nachforschungen über meinen Namensvetter an. Dort gab es kein integriertes Bibliothekssystem; die Bücher lagen einfach auf drei großen Haufen: Haufen A (das Weltall), Haufen B (Peguis-Fischereijahrbücher) und Haufen C (alles Mögliche). Das machte es mir nicht gerade einfach. Es stellte sich heraus, dass Johnny Appleseed ein amerikanischer Volksheld war, der dadurch berühmt wurde, dass er in West-Virginia Apfelbäume pflanzte. Ich begriff nicht, wieso wir im Zeltlager ein Lied über ihn sangen – ich hätte lieber was über Louis Riel, Häuptling Peguis oder Buffy St. Marie erfahren, statt einen Weißen zu ehren, der im amerikanischen Grenzland mit Apfelkernen um sich schmiss. Allem Anschein nach war er eine Art moralischer Märtyrer, der Jungfrau geblieben war, weil man ihm zwei Frauen im Himmel versprochen hatte. Ach, und ein Tierfreund war er auch; ich las, wie er ein Pferd rettete, indem er es mit Grashalmen fütterte, ganz im Geist von Walt Whitman. Ich verwette mein linkes Ei darauf, dass er auch ein Sklavenhalter war und seine Apfelbäume auf indianischem Gebiet pflanzte.
Eins weiß ich jedenfalls: Im Reservat sind Äpfel sauteuer, und in meinen Augen waren sie nun etwas Negatives. Mein Stiefvater Roger nannte mich einen Apfel, als ich ihm mitteilte, dass ich das Reservat verlassen will „Du bist außen rot“, sagte er, „und innen weiß.“
+ NDN: Die drei Buchstaben werden im Englischen wie „Endi-en / In-di-an“ ausgesprochen, es ist die Slangbezeichnung für die indigene Bevölkerung Nordamerikas.